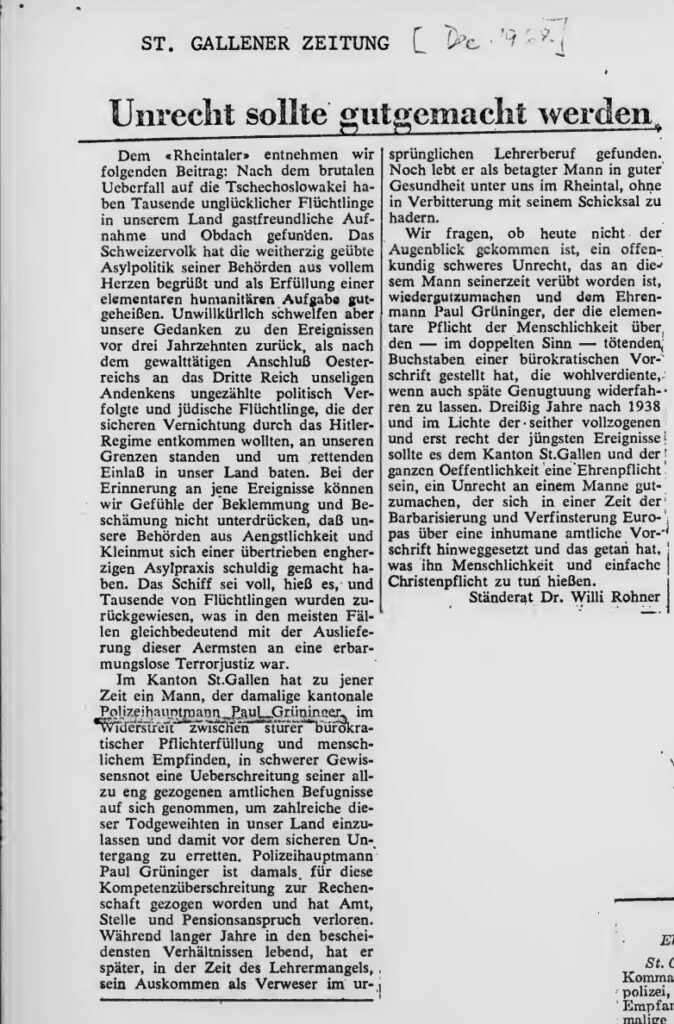Über 3000 jüdische Menschen konnten überleben
Paul Grüninger war kein glänzender Held aus einem Geschichtsbuch, sondern ein Mann mit Familie, Alltagssorgen und Fehlern – gerade das macht seine Geschichte so eindringlich. Er begegnete jüdischen Mitmenschen nicht als „Fälle“, sondern als Familien, als Mütter und Väter, als Kinder mit Namen und Hoffnungen, die vor einem mörderischen Antisemitismus flohen, der ihnen das Menschsein absprach. Wenn sie nachts an der Grenze auftauchten, hörte er das hastige Atmen der Erschöpften, sah frierende Kinderhände und Gesichter voller Panik – und entschied immer wieder neu: „Ich lasse sie durch.“
Viele der Menschen, die vor ihm standen, hatten hinter sich, was kein Mensch erleben sollte: enteignete Geschäfte, zerstörte Synagogen, Demütigungen auf offener Straße, „Schutzhaft“, erste Lageraufenthalte. Sie kamen aus Zügen, die sie wie Vieh transportiert hatten, trugen das Nötigste in Koffern, manchmal nur in Tüchern, und wussten: Wenn die Schweiz sie abweist, fallen sie zurück in die Hände derjenigen, die schon dabei waren, eine gesamte jüdische Kultur in Europa auszulöschen. Grüninger verstand, dass es hier nicht um abstrakte Politik ging, sondern um einzelne Leben, um Geschichten, um Sprachen, um Gebete, um ganze Familienlinien, die an dieser Grenze entweder weitergehen oder enden würden.
Wenn er danach nach Hause ging, tat er es mit dem Wissen, gegen Vorschriften verstoßen zu haben – nicht aus Eigennutz, sondern weil er sich weigerte, zum Rädchen im Getriebe der Vernichtungsmaschinerie zu werden. Während Kollegen in Aktenordnern blätterten und sich hinter Stempeln versteckten, schrieb er andere Daten in Papiere, setzte Unterschriften, die die Wirklichkeit „zurechtrückten“, damit aus „unerlaubt Eingereisten“ auf dem Papier Menschen mit gültiger Einreise wurden. Die Angst vor Entdeckung wird ihn begleitet haben: jedes Klopfen an der Tür, jede interne Untersuchung konnte das Ende seiner Laufbahn bedeuten – und doch wog für ihn die Vorstellung schwerer, jüdische Familien wissentlich zurück in den Tod zu schicken.
Die Strafe kam, wie er es geahnt haben muss. Er verlor seinen Posten, sein Einkommen und den Respekt vieler, die ihn früher als pflichtbewussten Beamten geschätzt hatten, während diejenigen, deren Leben er gerettet hatte, oft in der Fremde neu anfangen mussten, mit der Schuld der Überlebenden und der Trauer um Ermordete im Gepäck. Statt Auszeichnungen erhielt er einen Strafbefehl, statt Dankbarkeit das Stigma des „Gesetzesbrechers“ – und doch lebten irgendwo Kinder, die Bar‑Mizwa feiern konnten, Großeltern, die Geschichten weitererzählten, Familien, die jüdisches Leben in anderen Ländern fortsetzten, weil an der St. Galler Grenze ein einzelner Polizist Menschlichkeit über Vorschriften stellte.ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws+1
Gerade dieses Spannungsfeld macht seine Menschlichkeit so sichtbar: Er war weder Märtyrer noch Übermensch, sondern jemand, der die Rechnung kannte und sie trotzdem bezahlte. Er hatte sicher Momente des Zweifelns – ob es das wert war, ob er seiner Familie nicht zu viel aufbürdete –, aber jedes Mal, wenn er innerlich die Gesichter der jüdischen Männer, Frauen und Kinder sah, die ohne ihn an die SS ausgeliefert worden wären, dürfte ihm klar geworden sein, dass Nichtstun die eigentlich unerträgliche Entscheidung gewesen wäre.
Seine Geschichte macht Mut, weil sie zeigt, dass Zivilcourage nicht abstrakt ist, sondern immer im konkreten Blickkontakt beginnt: im Anerkennen des jüdischen Mitmenschen als Bruder und Schwester, denen man die Tür öffnet, wenn andere sie zuschlagen.