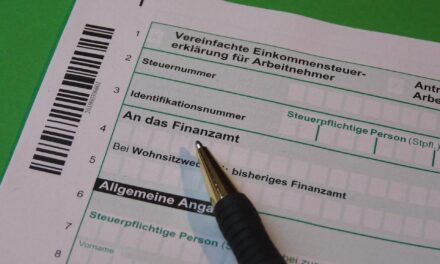Zug des Genderns: Eine unaufhaltsame Reise in die sprachliche “Gerechtigkeit”
Es war ein düsterer 1. September, präzise 05:45 Uhr morgens, als fünf Menschen in einem Raum saßen, die von Sorgen und Ängsten geplagt waren. Ihre Gesichter, in stiller Verzweiflung ins Halbdunkel des Raumes gehüllt, erzählten Geschichten von Ausgrenzung und sozialer Härte.
Jeder einzelne von ihnen suchte mit flehenden Blicken nach dem Arzt, der ihnen endlich Hilfe bringen könnte. Ein leises „Wo ist der Arzt?“ durchbrach schließlich die Stille, während das Gefühl von Hilflosigkeit wie ein Schatten über ihnen schwebte.
Als der Arzt den Raum betrat und die hoffnungslosen Gesichter sah, erstarrte er. Die Wucht der gesammelten Traurigkeit und der stillen Schreie nach Rettung trieb ihn fast aus dem Zimmer, doch dann sammelte er sich und trat mit Entschlossenheit ein. Einer nach dem anderen begannen die Patienten, ihre Ängste zu schildern. Es war nicht die alltägliche Sorge, die man von einem Gespräch beim Arzt erwarten würde. Sie fürchteten sich vor Rassismus, Diskriminierung, sozialer Härte – und vor der Sprache selbst.
Die deutsche Sprache, erklärten sie unisono, trenne die Menschen, weil sie nicht die weibliche und männliche Form gleichermaßen verwende. Statt „Mitarbeitende“ hieß es weiterhin „Mitarbeiter“, und genau darin sahen sie den Ursprung ihres Leides.
Der Arzt, erschüttert und voller Mitgefühl, drehte sich mit traurigen Augen um, verließ den Raum und ging in sein Büro zurück. Dort setzte er sich ans Telefon, griff zum Hörer und wählte die Nummer einer großen Zeitung. „Wir müssen über die Sprache sprechen – und über das, was sie mit uns macht“, sagte er leise, aber bestimmt.
Am anderen Ende der Leitung saß ein Redakteur, der selbst von einer gewissen inneren Unruhe geprägt war. Die Worte des Arztes trafen einen Nerv, und fast euphorisch stimmte er zu. „Es ist die Sprache, die uns trennt“, sagte er. „Aber ich weiß, wie wir das lösen können.“ Binnen Stunden setzte er die Medienwelt in Bewegung und überzeugte alle, dass die einzige Rettung im konsequenten Gendern läge.
Bald schon war eine Bewegung in Gang gesetzt, die von einer gewaltigen Entschlossenheit getragen wurde: Gendern sollte zur neuen Norm werden, der Weg in eine gerechtere Welt.
Und so erschien wenig später auf den Titelseiten der große Aufmacher: „Der Zug des Genderns: Nun beginnt die Fahrt in die sprachliche Gerechtigkeit.“ Ein Bild eines pünktlich fahrenden Zuges zierte die Seite, als Sinnbild eines Aufbruchs, der keine Verzögerungen oder Weichenstellungen mehr kannte.
Dieser Zug, getrieben von einer beispiellosen Entschlossenheit, schien wie befreit von den sonst so üblichen Eigenheiten der deutschen Bahn. Ungehindert und ohne Umwege rollte er durchs Land.
Schnell erkannten auch die ersten Politiker das Potenzial dieser Bewegung und sprangen auf den Zug auf. Es war offensichtlich, dass dies weniger aus tiefster Überzeugung geschah, sondern aus klarem Eigeninteresse: Hier winkten Wählerstimmen.
Kaum einer konnte sich entziehen, und mit markigen Worten traten die politischen Akteure vor die Mikrofone und erklärten, wie notwendig und fortschrittlich das Gendern sei. Zwischen den Zeilen allerdings war unschwer zu erkennen, dass weniger das Wohl der Bürger, als vielmehr das eigene politische Ticket zur nächsten Wahl den Ausschlag gab.
Doch damit nicht genug: Bald forderte man, dass alle literarischen Werke, die nicht den Anforderungen des neuen Sprachgebrauchs entsprachen, umgeschrieben werden müssten. Klassiker, Kinderbücher, moderne Romane – alles sollte dem neuen Ideal angepasst werden. „Immerhin“, so kommentierte man stolz, „ist das Umschreiben doch allemal besser, als Bücher zu verbrennen.“ Und so wurden die Texte der alten Meister zügig angepasst, eine Zeile nach der anderen in die modernen Ideale gebogen.
Die Frage, wie viel von der Geschichte dabei auf der Strecke blieb, wagte kaum jemand laut zu stellen.
Der Zug des Genderns fuhr unterdessen unaufhaltsam weiter. Es gab keine Haltestellen mehr, keine Weichen, die zur Kurskorrektur führen könnten.
Die Richtung war festgelegt, und an jeder Station, die er passierte, flatterten stolz die Fahnen in den Farben der Vielfalt, mit der klaren Botschaft: „Gendern ist toll!“ Niemand stellte sich mehr in den Weg; die Fahrt ging zielstrebig voran, als gäbe es kein Zurück.
Und so rollte der Zug weiter, durch Städte und Dörfer, unaufhaltsam auf sein Ziel zu – eine „Endlösung“ für die deutsche Sprache, wie sie nie zuvor in solcher Konsequenz angestrebt worden war.
Und wenn sie nicht gestorben sind, wenn sie nicht in einem Lager konzentriert und für die Ideale der neuen Sprache zusammengeführt wurden, dann leben sie noch heute – irgendwo am Rande der Gleise, vielleicht im Schatten eines vergessenen Bahnhofs, an dem dieser Zug niemals mehr halten wird.