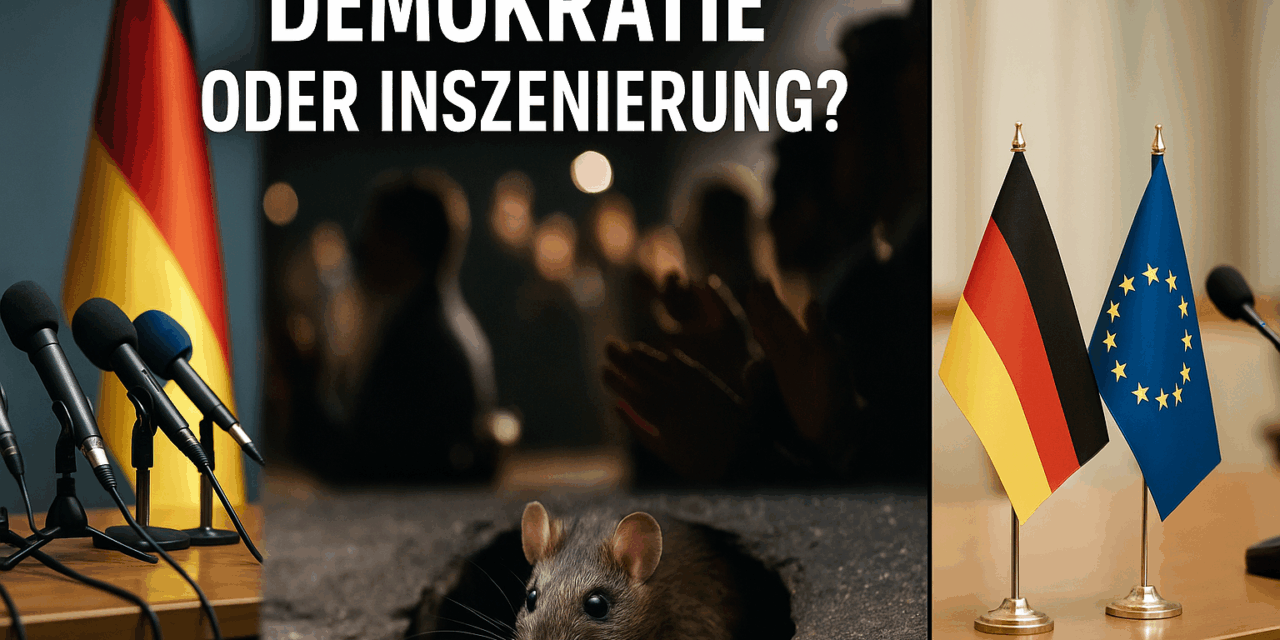Die Einstufung der AfD als rechtsextrem durch den Verfassungsschutz erfolgte ohne die gleichzeitige Veröffentlichung konkreter Beweise, just zu einem Zeitpunkt, als die Partei in Umfragen einen deutlichen Stimmungszuwachs verzeichnete – und zwar an einem langen Wochenende, während sich das Land noch unter der Führung einer bereits abgewählten, geschäftsführenden Bundesregierung befand.
Im politischen Berlin war die Reaktion auf die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz kaum verhalten. Kaum war die Nachricht publik, entfaltete sich ein fast schon orchestrierter Reigen an Stellungnahmen, Pressemitteilungen und Talkshowauftritten – als hätten viele nur auf das Signal gewartet, endlich ungehemmt loslegen zu können.
Manch ein Akteur zeigte dabei weniger staatsmännische Zurückhaltung als vielmehr eine bemerkenswerte Genugtuung. Die Wortwahl vieler Kritiker wirkte nicht wie nüchterne Analyse, sondern triefte vor moralischer Überlegenheit – fast, als gehe es nicht um eine ernste verfassungsrechtliche Einordnung, sondern um einen wohlgeplanten Moment öffentlicher Vorführung.
In sozialen Netzwerken und den Leitartikeln etablierter Medien verstärkte sich der Eindruck eines kollektiven Aufatmens unter jenen, die die AfD ohnehin nicht als politischen Gegner, sondern als demokratische Anomalie betrachten. Wer genau hinsah, konnte erkennen, wie schnell bestimmte Kreise – nicht selten dieselben, die sonst mit Pathos zur Mäßigung mahnen – nun ihre Maske der Sachlichkeit fallen ließen und mit bemerkenswerter Hingabe in das bekannte Muster aus Ausgrenzung, Empörung und moralischer Herablassung verfielen.
Es war weniger ein Aufschrei als ein Auftritt. Und man fragt sich unweigerlich, ob es dabei noch um Verfassungsschutz geht – oder längst um etwas anderes.
Auch ein Großteil der etablierten Medien zeigte in der Berichterstattung über die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz ein bemerkenswert einheitliches Bild. Nicht wenige Beobachter fühlten sich dabei weniger an journalistische Vielfalt als vielmehr an die Mechanismen einer Meinungslenkung erinnert, wie man sie sonst nur in staatsnahen Informationskanälen erwartet.
Leitartikel, Kommentare und Sendebeiträge reihten sich oft nahtlos aneinander, als sei der Tenor zuvor abgestimmt worden. Die wenigen differenzierteren Stimmen – sei es in Hinblick auf das Verfahren, den Zeitpunkt oder die fehlende Offenlegung belastbarer Belege – gingen nahezu unter im Chor der Entrüstung. Statt kritischer Distanz zum Staat wirkte manches Medium, als sei es aktiv Teil einer Kampagne und nicht mehr deren Begleiter.
Besonders auffällig war dabei, wie schnell und bereitwillig zentrale Narrative übernommen wurden: von der unreflektierten Weitergabe der Einordnung „rechtsextrem“ bis hin zur Warnung vor einem angeblich drohenden Systemumsturz – Formulierungen, die ansonsten mit journalistischer Vorsicht begegnet werden. Doch diesmal war alles anders.
Die vierte Gewalt zeigte sich nicht als Kontrollinstanz, sondern als Verstärker. Und das lässt viele, auch politisch Andersdenkende, nicht unberührt zurück.
Besonders irritierend wirkt in diesem Zusammenhang das Verhalten des Auswärtigen Amtes, das auf eine scharfe Kritik aus den Vereinigten Staaten mit dem lapidaren Satz „Das ist Demokratie“ reagierte – und damit in einer Tonlage, die nicht nach außenpolitischer Reife, sondern nach belehrender Selbstgefälligkeit klang.
Während Vertreter der Bundesregierung und etablierter Parteien nicht davor zurückschrecken, gegenüber anderen Ländern, insbesondere den USA, harte Worte zu wählen – sei es in Fragen der Migrationspolitik, des Rechtssystems oder gesellschaftlicher Entwicklung –, scheint im eigenen Haus ein anderes Maß zu gelten.
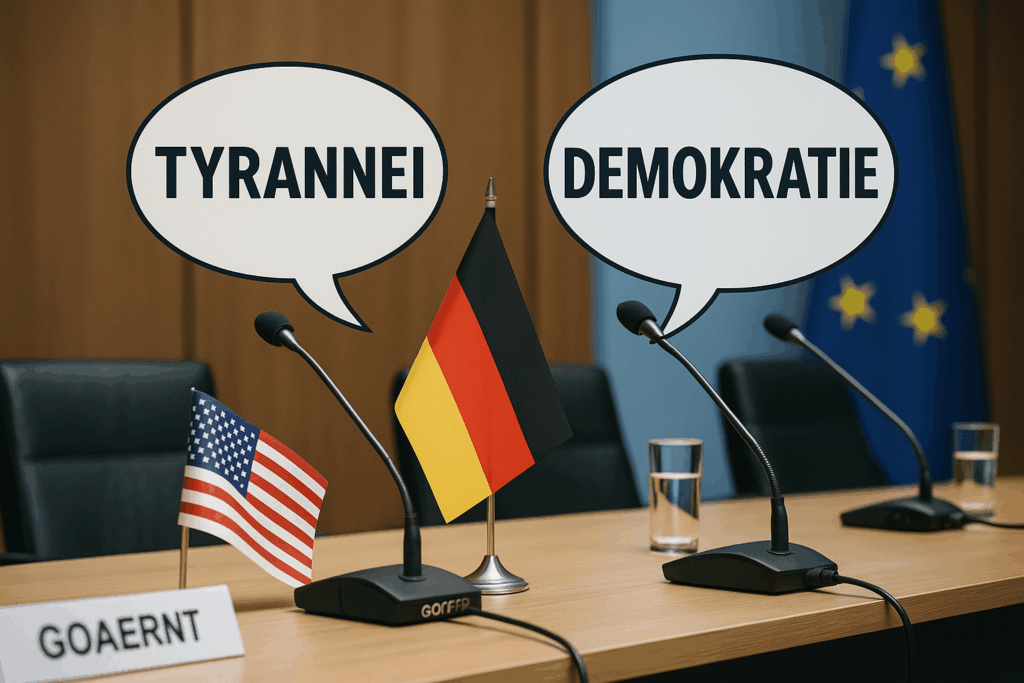
Dass die Kritik aus Washington die Formulierung einer „verdeckten Tyrannei“ verwendet, wurde hierzulande nicht etwa ernsthaft hinterfragt oder diskutiert – vielmehr übernahmen manche Medien diesen Begriff fast schon eifrig, sparten sich aber den Zusatz „verdeckt“. Plötzlich war nur noch von „Tyrannei“ die Rede – ganz offen und ohne die sonst üblichen Differenzierungen, die in anderen Kontexten stets eingefordert werden.
In dieser aufgeheizten Atmosphäre wirkt es geradezu zynisch, wenn ausgerechnet die Berufung auf „Demokratie“ dazu dient, über 10 Millionen Wähler einer großen Oppositionspartei moralisch zu delegitimieren, auszugrenzen und pauschal zu diffamieren. Demokratie ist kein Totschlagargument – sie ist ein Versprechen auf Vielfalt, nicht ein Vorwand zur Gleichschaltung.